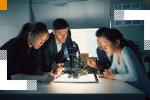Aus unserer Praxis: ESG und Transfer Pricing
30 November, 2022
Von Gerrit Halbach und Dr. Isabel Ruhmer. Das Thema ESG ist in aller Munde. Die Begrifflichkeit ESG steht für eine Orientierung an den Bereichen Environment (Umwelt), Social (Gesellschaft) und Governance (Unternehmensführung).
ESG strahlt in die gesamte DNA von Unternehmen aus und hat damit auch Verrechnungspreisimplikationen. Um diese Aspekte strukturiert zu beleuchten, unterscheiden wir in unmittelbare und mittelbare Implikationen.

Regulatorisches Umfeld
Die hohe Relevanz von ESG zeigt sich in bereits bestehenden, umfangreichen regulatorischen Anforderungen und perspektivisch noch zunehmenden Entwicklungen. Dabei sind einerseits globale Regelwerke wie die Standards der Global Reporting Initiative (GRI) für die Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie europäische Initiativen wie der europäische Green Deal, die EU-Taxonomie und auch das Public Country-by-Country Reporting (CbCR) zu nennen. Andererseits sind beispielhaft auch das in Deutschland mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 anwendbare Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz zu nennen, das hohe, sanktionsbehaftete Anforderungen setzt, um das Ziel der Verringerung oder Vermeidung potenzieller Risiken in Bezug auf Menschenrechte und Umweltbelange in der Lieferkette zu erreichen.
Unmittelbare Verrechnungspreis-relevanz
Zu den Implikationen mit unmittelbarer Verrechnungspreisrelevanz zählt in erster Instanz die Sicherstellung und Umsetzung der regulatorischen Reportingpflichten. Gerade im Steuerbereich sind neben obligatorischen Reportingpflichten im ESG Kontext auch fakultative Elemente, wie beispielsweise GRI 207, verstärkt zu beobachten. Diesbezüglich besteht (noch) ein recht weites Spektrum dahingehend, wie Unternehmen in ihren Nachhaltigkeitsberichten bezüglich Steuern und Verrechnungspreise extern berichten. Hier erwarten wir eine stetige Vereinheitlichung und Standardsetzung durch Vorreiter in Form von Best Practices.
Daneben stellt sich die operative Frage: Wer übernimmt welche ESG Verantwortlichkeit in Unternehmensgruppen? Dies sollte der Ausgangspunkt sein für eine Einschätzung der Behandlung der ESG Funktion an sich. Der Wertschöpfungsbeitrag kann hierbei grundsätzlich von einer Routinefunktion bis zu einer strategischen Funktion – mit Einfluss auf die wesentlichen Gewinn- und Werttreiber einer Unternehmensgruppe – reichen. Auf dieser Basis ist festzulegen, ob und wie eine ESG Funktion konzernintern zu verrechnen ist (beispielsweise eher kostenbasiert als Dienstleistung bis hin zur denkbaren Anwendung der Gewinnaufteilungsmethode in Abhängigkeit des Einflusses auf Unternehmenscharakterisierung und Werttreiber). Wir empfehlen dies proaktiv einzuschätzen und in den Verrechnungspreisdokumentationen zu adressieren.
Mittelbare Verrechnungspreis-relevanz
Zu den Implikationen mit mittelbarer Verrechnungspreisrelevanz zählt jegliche durch ESG-Maßnahmen implizierte Veränderung von Wertschöpfungsketten. Beispielhaft seien folgende Konstellationen genannt mit Fragestellungen aus Verrechnungspreissicht:
- (Zentrale) Einkaufsfunktion mit Übernahme der Sorgfaltspflichten einschließlich Risiken aus dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – Welchen Einfluss hat dies auf die Klassifizierung und Vergütung der Einkaufsfunktion?
- Einbettung von ESG-Aspekten in der Lieferkette durch zum Beispiel Umstellung der Energieversorgung von Auftragsfertigern – Wer trägt die Produktionsmehrkosten und wie sind die Auswirkungen auf Kostenbasis und Gewinnaufschlag?
- Veränderte Lieferanten durch höhere soziale und umweltbezogene Sorgfaltspflichten verursachen höhere Produktionskosten – Entstehen neue oder veränderte Lieferketten mit Implikationen auf das bestehende Verrechnungspreismodell?
- (Zentraler) Erwerb von CO2-Emissionszertifikaten – Wie sind die Erwerbskosten gegebenenfalls an ultimative Nutznießer zu verrechnen, und zu welchem Preis?
Daneben sind ESG-Implikationen gerade auch im Kontext von Deals aus Investorensicht verstärkt im Fokus. Hierfür sprechen auch die diversen verfügbaren Sustainability Ratings und Rankings. Eine ähnliche Schwerpunktsetzung ist auch zunehmend bei Finanztransaktionen zu beobachten, unter anderem bei der Bestimmung von Ratings durch die Ratingagenturen. Hier ist eine Auswirkung auf interne Finanzierungsstrukturen im Blick zu behalten.
Fazit und Ausblick
Es empfiehlt sich aus der Steuerfunktion heraus proaktiv mit dem Thema ESG innerhalb der jeweiligen Unternehmensgruppe umzugehen (Reporting-seitig wie funktional). Ausgehend von einer Identifizierung der ESG-Verantwortlichkeiten sollte eine Einschätzung der ESG-Relevanz und deren Implikationen auf Funktions- und Risikoprofile erfolgen. Darüber hinaus ist es umso wichtiger nah am Business zu sein, um ESG-bedingte Veränderungen frühzeitig auch steuerlich und aus Verrechnungspreissicht zu begleiten.