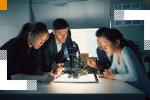Pflegenotstand hausgemacht? Die Grenzen ambulanter Pflege
21 Januar, 2020
Ein Interview mit Roland Engehausen (Vorstand der IKK Südwest), Jens Keil (CFO der Linimed-Gruppe, einem Anbieter ambulanter Intensivpflege), Markus Müller (CEO des Software-Entwicklers Nui Care, der eine App für pflegende Angehörige anbietet) und Michael Burkhart (Partner bei PwC und bis Juli 2023 Leiter des Bereichs Gesundheitswesen und Pharma). In unserer Gesellschaft wächst der Anteil alter und kranker Menschen, die im Alltag auf Unterstützung angewiesen sind.
Das verlangt dem Gesundheitswesen immer mehr ab. Generell zielt die Politik darauf, Pflegebedürftige eher ambulant als in Heimen zu versorgen. Doch bei der Intensivpflege stößt dieser Grundsatz an seine Grenzen, wie das Treffen des Gesundheitsclubs Rhein-Main am 6. November 2019 zeigte. Unter dem Motto „Pflege ist nicht gleich Pflege: Zukunftstrend Mobile Care“ informierte sich die Runde über die aktuelle Situation und diskutierte, welche Modelle bei der Versorgung Pflegebedürftiger zukunftsfähig sind.

Herr Burkhart, im Gesundheitsclub Rhein-Main haben Sie Ihr Augenmerk diesmal auf die ambulante Intensivpflege gelegt. Warum?
Michael Burkhart: Das Thema ist gerade aktuell. Derzeit liegt ein Referentenentwurf für das „Gesetz zur Stärkung von Rehabilitation und intensiv-pflegerischer Versorgung“ – kurz Reha- und Intensivpflege-Stärkungsgesetz RISG – vor, das im kommenden Jahr verabschiedet werden soll. Es geht darin um die Versorgung schwer kranker Menschen, die rund um die Uhr gepflegt werden und teilweise auf spezielle Geräte zur Beatmung angewiesen sind. Derzeit werden drei Viertel dieser Patienten zu Hause betreut.
Menschen im Alter ambulant zu Hause zu versorgen ist ja politisch gewollt. Wo liegt also das Problem?
Roland Engehausen: Bei der ambulanten Intensivpflege geht es nicht nur um die Verrichtung von Alltäglichkeiten. Dort sind aufwendige Geräte nötig, die bei der Pflege zu Hause dann für jeden Patienten einzeln vorgehalten werden. Das ist nicht ganz billig und angesichts steigender Patientenzahlen langfristig wohl kaum zu stemmen. Hinzu kommt, dass Hygiene- und Qualitätsstandards im privaten häuslichen Umfeld viel schwieriger einzuhalten und zu überwachen sind. In Heimen wäre die Versorgung besser und effizienter möglich. Doch das scheitert derzeit oft bereits daran, dass Pflegeheime nach der derzeitigen Gesetzeslage durch hohe Eigenanteile für Schwerkranke zu teuer sind. Das ist ein politischer Fehlanreiz, der fatale Folgen für das gesamte System hat: Denn abgesehen von den hohen Kosten bindet die häusliche 1:1-Pflege unverhältnismäßig viele Fachkräfte. Deswegen ist ein Teil des Pflegenotstandes in dieser Hinsicht nach meiner Einschätzung hausgemacht.
Ist eine Versorgung in Wohngruppen eine Alternative?
Engehausen: Grundsätzlich schon, weil Wohngruppen im Vergleich zu Pflegeheimen familiär und überschaubar sind. Gleichzeitig lassen sie einen effizienten Einsatz von Fachkräften und Technik zu. Auch hygienische Anforderungen sind in Räumen, die von vornherein dafür ausgestattet sind, viel besser einzuhalten. Doch im Moment stellen solche Wohngruppen noch eine Grauzone dar. Da tummeln sich unter den Leistungserbringern zu viele schwarze Schafe. Denn bisher gibt es kaum Regeln für diese Mischform zwischen ambulanter und stationärer Intensivpflege. Das soll sich aber mit dem Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz (IPReG) verbessern, da sowohl Qualitätsstandards als auch Heimaufsicht klar geregelt und auch die Beatmungsentwöhnung besser vergütet werden.
Jens Keil: Die Schwierigkeit, qualitative Aspekte wie Hygiene und die Fachlichkeit in der Pflege zu überprüfen, stellt sich vor allem in der sogenannten 1:1-Versorgung – also dort, wo der Patient in seiner häuslichen Umgebung versorgt wird. Dort gibt es keine Instanz, die einer Heimaufsicht entspricht, auch der MDK kontrolliert dort nicht regelmäßig. Mit entsprechend krimineller Energie lässt sich das leicht ausnutzen. Aus unserer Sicht mangelt es in der ambulanten Pflege also weniger an Qualitätsstandards, sondern an der nötigen Umsetzung und Überwachung.
Sollten Menschen, die auf ambulante Intensivpflege angewiesen sind, in Zukunft grundsätzlich stationär untergebracht werden?
Engehausen: Das IPReG sieht in der Intensivpflege zukünftig im Normalfall die stationäre Versorgung vor und die Eigenanteile im Heim sollen entsprechend deutlich reduziert werden. Dies zielt nach meiner Auffassung auch in die richtige Richtung, wobei unter Würdigung der Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben Ausnahmen erforderlich sind. Kinder fallen darunter. Sie sind in ihrer Familie natürlich am besten aufgehoben. Ebenso gilt dies für Patienten, die mit der Beatmung auch berufstätig sein können. Und auch Patienten, die nicht mehr lange zu leben haben, sollten weiterhin zu Hause versorgt werden können. Ansonsten erwarten wir aber, dass in Zukunft mehr und mehr Intensivpflege-Patienten stationär versorgt werden, wenn die individuelle Lebenssituation nicht dagegen steht. Dazu wird noch ein gesellschaftspolitischer Dialog nötig sein, weil dies nach Auffassung von Behindertenverbänden dem Selbstbestimmungsrecht nach UN-Behindertenrechtskonvention entgegensteht und teilweise sogar vor einem „Beatmungsknast“ gewarnt wird. Aus der Sicht guter qualitätsgesicherter Patientenversorgung sehen wir im neuen Gesetz große Vorteile und Chancen. Es wird noch Überzeugungsarbeit nötig sein und Ausnahmen müssen möglich bleiben.
Burkhart: Es wird häufig selbstverständlich angenommen, dass pflegebedürftige Menschen zu Hause am besten versorgt sind. Ob das wirklich stimmt? Gerade bei der Gruppe der Intensiv-Patienten lässt sich Lebensqualität und Zufriedenheit nur schwer beurteilen. Schließlich sind darunter viele alte Menschen, die sich nicht klar äußern können. Um zu Erkenntnissen zu gelangen, wäre es nötig, Pflegende, Angehörige und Gepflegte regelmäßig zu befragen. So ein Benchmarking-Konzept hat übrigens in den Niederlanden in der Pflege zu einer signifikanten Steigerung der Qualität geführt.
Markus Müller: Ich kann nur unterstreichen, wie sinnvoll es ist, Angehörige bei der Beurteilung der Pflegesituation mit einzubeziehen. Das hat sich auch bei der Entwicklung unserer Pflege-App gezeigt. Zunächst hatten wir uns auf die Betroffenen selbst konzentriert. In der Testphase haben wir dann aber gemerkt, wie wichtig der Austausch mit Angehörigen ist – gerade wenn es um organisatorische Fragen geht. Wir haben auf diese Weise viele Impulse zur Weiterentwicklung der Nui-App erhalten.
Abschließend zum Gesundheitsclub selbst: Wie hat Ihnen die Diskussion in dieser Runde gefallen?
Engehausen: Ich fand es sehr angenehm, mich unabhängig vom Tagesgeschäft über die Herangehensweise seriöser Pflegedienste zu informieren. Auch die Vorstellung der Pflege-App war für mich interessant, weil wir als gesetzliche Krankenkasse gerade darüber nachdenken, unseren Versicherten solche Lösungen zur Verfügung zu stellen.
Müller: Für uns als Startup ist das eine Chance, uns vor einem Publikum mit 25 Vertretern aus allen Bereichen der Gesundheitswirtschaft zu präsentieren. Eine tolle Sache!
Keil: Die Beiträge und Rückfragen haben an verschiedenen Stellen gezeigt, wie wenig die verschiedenen Player im Gesundheitswesen voneinander wissen – gerade wenn es um die Praxis in der Pflege geht. Ein fundierter Austausch ist insofern enorm wichtig. Da erweist sich der Gesundheitsclub Rhein-Main als gute Plattform.
Contact us

Roland M. Werner
Partner, Leiter Gesundheitswirtschaft & Pharma, PwC Germany
Tel.: +49 170 7628-557