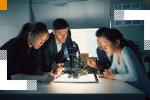Angesichts der globalen Erwärmung hat die Bedeutung nachhaltiger Fertigungsprozesse heute einen Höhepunkt erreicht. Die Industrie zeichnet sich durch einen hohen Verbrauch an Ressourcen und Energie aus und trägt einschließlich des Verbrauchs von Energie und Wärme zu etwa 40 Prozent der weltweiten CO₂-Emissionen bei. Ein erheblicher Teil dieser Emissionen stammt aus der Produktion von Basisstoffen wie Stahl, Aluminium, Kunststoffen und Zement. Prognosen zufolge könnte der Bedarf an diesen Materialien bis 2050 um das Zwei- bis Vierfache steigen. Wir helfen Ihnen, Ihr Nachhaltigkeitspotenzial voll auszuschöpfen.